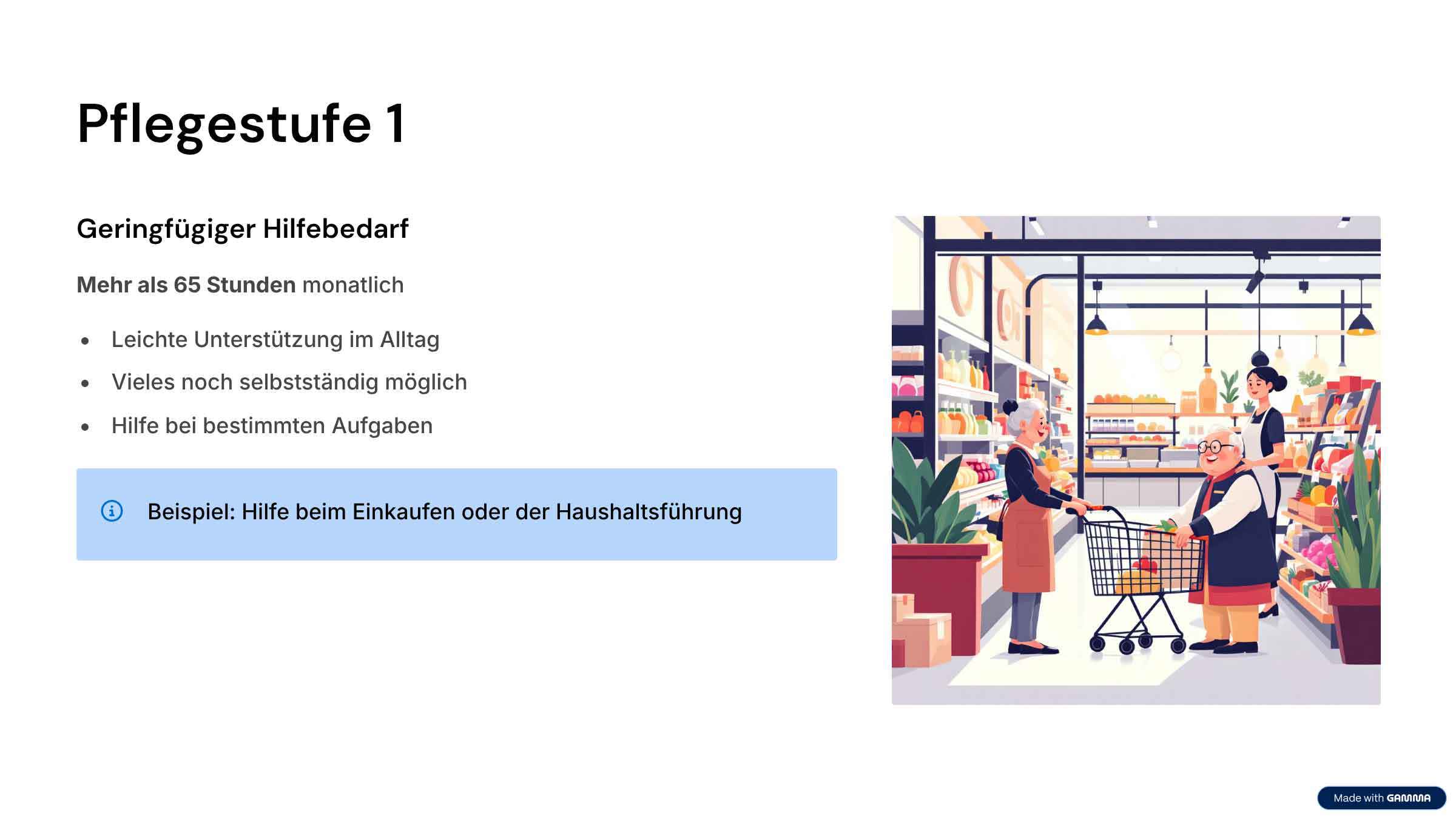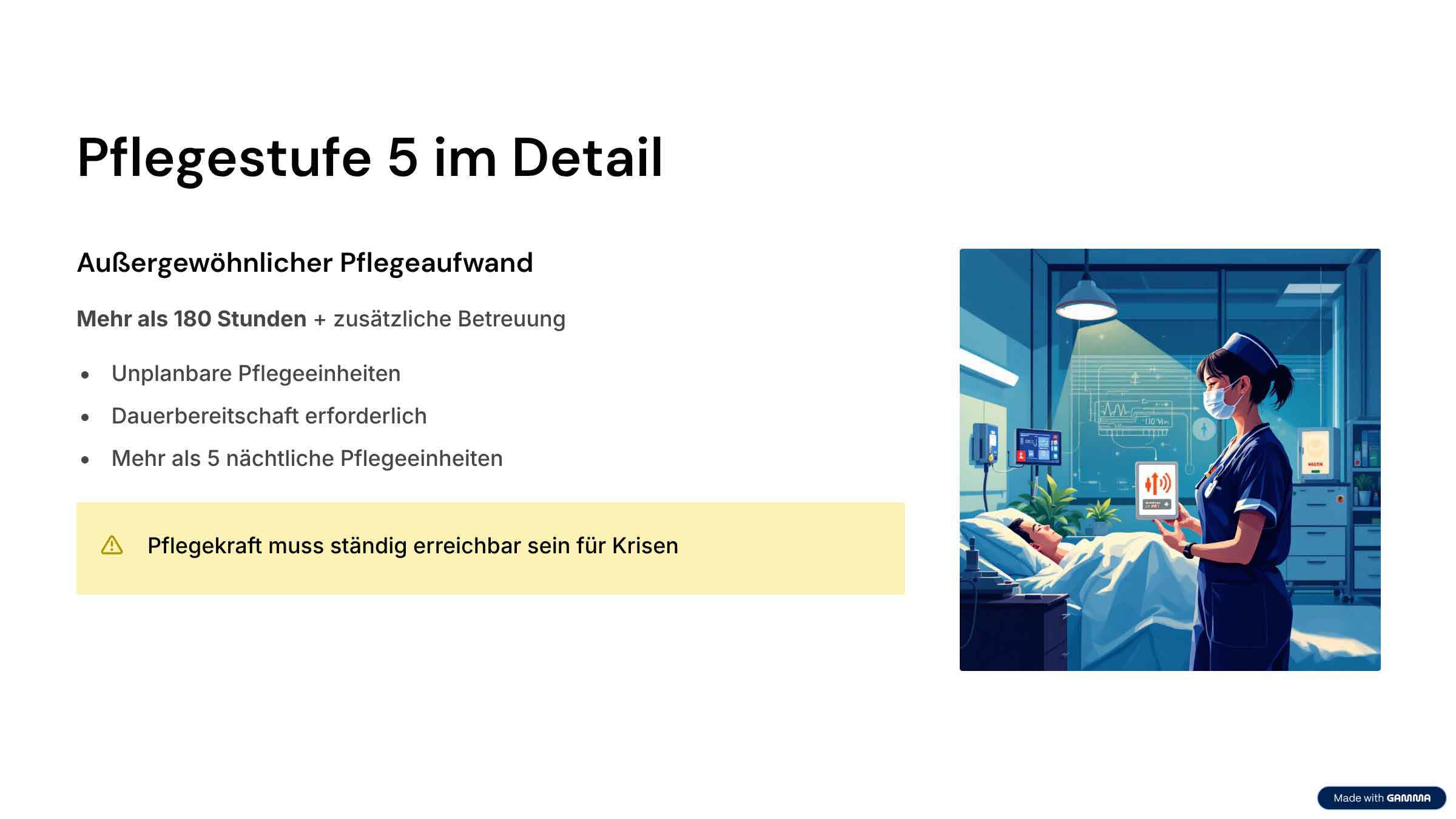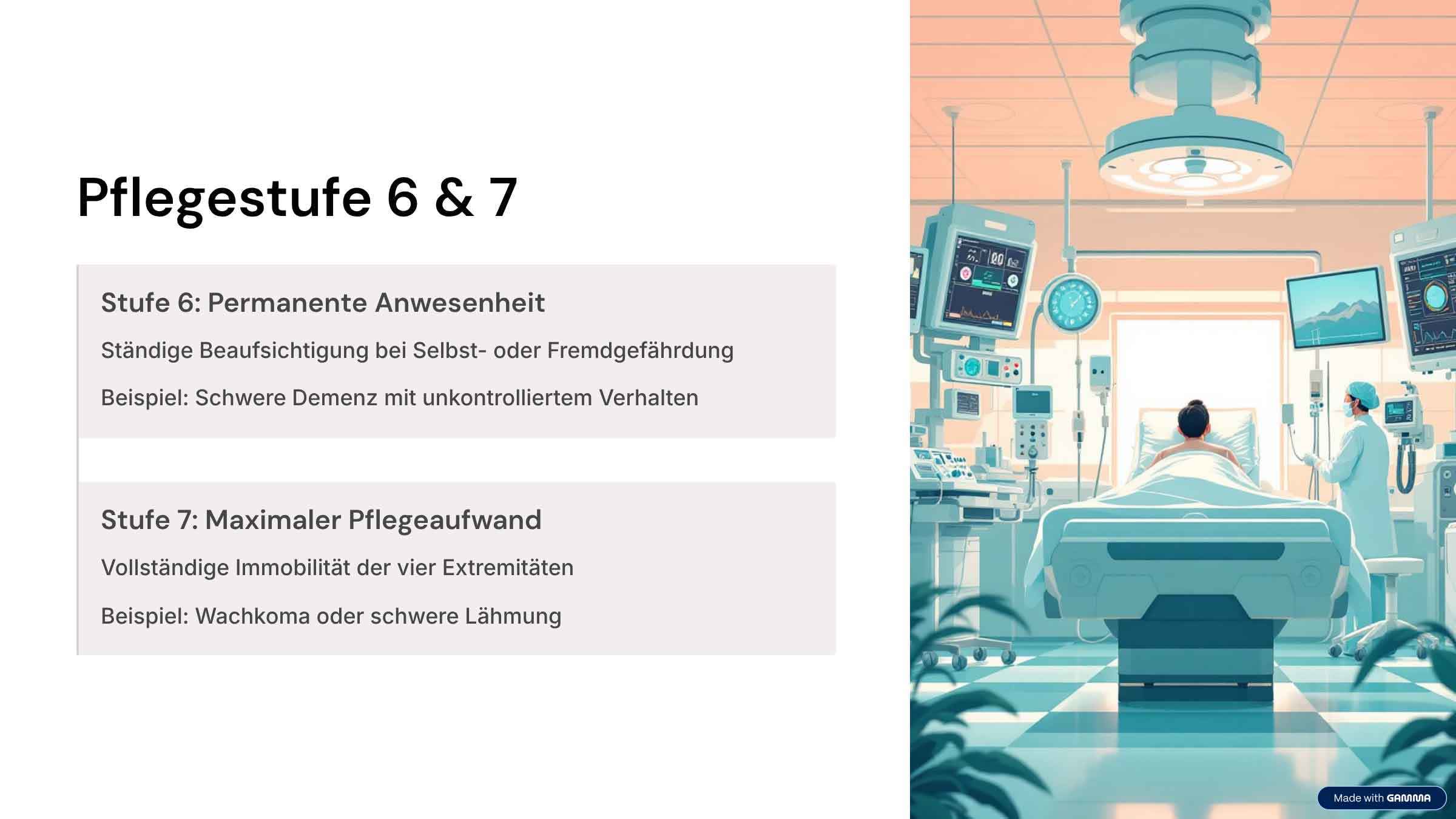Pflegestufen 1- 7 in Österreich: Leistungen und Pflegegeld im Überblick
Verschaffe Dir einen Überblick über die Pflegestufen 1 bis 7. Informiere Dich über die Voraussetzungen für die Einstufung in eine bestimmte Pflegestufe. Erfahre, welche Leistungen Dir oder Deiner Familie zustehen.
In Österreich gibt es sieben Pflegestufen, die darüber entscheiden, wie viel Pflegegeld eine Person erhält – je nach dem individuellen Pflegebedarf. Doch wer versteht auf Anhieb, welche Stufe wann gilt? Was bedeuten 65 oder 180 Pflegestunden im Alltag? Und wie stellt man überhaupt einen Antrag?
Wenn Du Dich gerade fragst, ob Du oder ein Angehöriger Anspruch auf Pflegegeld hast, bist Du nicht allein. Viele Familien stehen plötzlich vor dieser Herausforderung – oft ohne klare Antworten. In diesem Leitfaden findest Du einfach erklärte Informationen zu allen Pflegestufen in Österreich, die aktuellen Beträge für 2025, sowie eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Antragstellung. Wir zeigen Dir, was in welcher Stufe gilt, wie Du den Bedarf einschätzen kannst und worauf Du bei Demenz, Kinderpflege oder 24-Stunden-Betreuung besonders achten solltest.
Pflegegeld gibt es in Österreich seit dem Jahr 1993. Es ist eine pauschale Geldleistung, mit der der finanzielle Aufwand, der durch das Pflegebedürfnis entsteht, zumindest teilweise abgedeckt werden soll. Mit dieser Strategie soll die häusliche Pflege gestärkt und der Verbleib in den eigenen vier Wänden gefördert werden. Das Ausmaß des Pflegegeldes richtet sich nach dem Pflegebedarf. Es sind sieben Stufen vorgesehen (Quelle: oesterreich.gv.at).
Die Höhe des Pflegegeldes hängt von der jeweiligen Pflegestufe ab, in die die zu pflegende Person eingestuft wurde. Diese Pflegestufe definiert sich wiederum durch die Anzahl an Stunden, die für den notwendigen Pflegeaufwand pro Monat aufgebracht werden müssen. Dabei werden nicht nur rein körperliche, sondern auch kognitive und psychische Hilfsbedarfe berücksichtigt. Hinter jeder einzelnen Pflegestufe steht also ein spezifischer Leistungskatalog, der den Umfang der benötigten Unterstützung detailliert festlegt.
Pflegebedarf liegt vor, wenn jemand aufgrund einer körperlichen, geistigen oder psychischen Behinderung regelmäßig Hilfe benötigt (Quelle: pflege.gv.at). Dies gilt als zentrale Voraussetzung für die Gewährung des Pflegegeldes. Der Pflegebedarf muss dabei voraussichtlich länger als sechs Monate andauern, um als solcher anerkannt zu werden.
Pflegegeld 2025 – Überblick nach Pflegestufe
Ab dem 1. Januar 2025 werden die Pflegegeldbeträge um 4,6 % erhöht (Quelle: finanz.at – Pflegegeld). Das Pflegegeld wird – je nach Ausmaß des erforderlichen Pflegebedarfs und unabhängig von Alter und Ursache der Pflegebedürftigkeit – in sieben Stufen gewährt (Quelle: Sozialministerium.gv.at).
Hier siehst Du die Pflegestufe, den monatlichen Pflegebedarf und die damit verbundene Leistung auf einen Blick:
Die 7 Pflegestufen im Detail: Was sie in der Praxis bedeuten
Die Einstufung in eine Pflegestufe mag auf den ersten Blick eine rein rechnerische Angelegenheit sein. Doch hinter den Stundenangaben verbirgt sich der individuelle Alltag eines Menschen. Die folgenden Beispiele sollen Dir veranschaulichen, welche Art von Unterstützung mit den jeweiligen Stufen verbunden ist.
Pflegestufe 1: Geringfügiger Hilfebedarf
- Pflegebedarf: monatlich mehr als 65 Stunden.
- Erklärung: Diese Stufe gilt für Personen, die bei alltäglichen Verrichtungen nur leichte Unterstützung benötigen. Sie können noch vieles selbstständig erledigen, benötigen aber Hilfe bei einigen, bestimmten Aufgaben.
- Beispiel: Ein älterer Mensch, der Schwierigkeiten beim Einkaufen oder der Haushaltsführung hat. Er benötigt vielleicht jemanden, der einmal pro Woche die schweren Einkäufe erledigt oder bei der Reinigung der Wohnung hilft.
Pflegestufe 2: Regelmäßige Unterstützung
- Pflegebedarf: monatlich mehr als 95 Stunden.
- Erklärung: Der Pflegebedarf ist hier bereits regelmäßiger und betrifft mehrere Bereiche. Die Person benötigt mehrmals pro Woche Unterstützung bei der Körperpflege oder bei der Zubereitung der Mahlzeiten.
- Beispiel: Jemand, der beim Duschen, Haarewaschen oder Ankleiden nicht mehr allein zurechtkommt und mehrmals wöchentlich Hilfe benötigt. Auch die Organisation der Medikamente ist ohne Unterstützung nicht mehr möglich.
Pflegestufe 3: Hoher Betreuungsbedarf
- Pflegebedarf: monatlich mehr als 120 Stunden.
- Erklärung: Ab dieser Stufe ist der Pflegebedarf so hoch, dass er eine tägliche, umfassende Unterstützung erfordert. Dies ist oft die Stufe, ab der eine 24-Stunden-Betreuung in Betracht gezogen wird und Förderungen dafür wahrscheinlicher werden.
- Beispiel: Ein Mensch, der täglich Hilfe bei der Körperhygiene, bei den Mahlzeiten und bei der Mobilität im Haus benötigt. Die Person kann sich nur mit Unterstützung im Alltag bewegen.
Pflegestufe 4: Schwerer Pflegebedarf
- Pflegebedarf: monatlich mehr als 160 Stunden.
- Erklärung: Bei dieser Stufe ist der Pflegebedarf sehr schwerwiegend und umfasst fast alle Bereiche des täglichen Lebens. Die Betreuung ist rund um die Uhr nötig, auch nachts.
- Beispiel: Ein Patient, der permanent auf den Rollstuhl angewiesen ist und bei allen Verrichtungen des täglichen Lebens (Essen, Trinken, Waschen, Anziehen) umfassende Hilfe benötigt.
Pflegestufe 5: Außergewöhnlicher Pflegeaufwand
- Pflegebedarf: monatlich mehr als 180 Stunden. Zusätzlich muss ein außergewöhnlicher Pflegeaufwand vorliegen.
- Erklärung: Die Person benötigt mehr als 180 Stunden Pflege im Monat, plus eine zusätzliche Betreuung, die nicht planbar ist. Das kann zum Beispiel der Fall sein, wenn eine Pflegekraft in Dauerbereitschaft sein muss, oder wenn nachts mehr als 5 Pflegeeinheiten erforderlich sind.
- Beispiel: Ein Patient mit einer schweren Erkrankung, die nächtliche Kontrolle und Unterstützung erfordert. Die Pflegeperson muss ständig erreichbar sein, auch wenn sie nicht dauerhaft anwesend ist, um auf plötzliche Krisen reagieren zu können.
Pflegestufe 6: Permanente Anwesenheit
- Pflegebedarf: monatlich mehr als 180 Stunden. Zusätzlich muss die dauernde Anwesenheit einer Pflegeperson tags und nachts erforderlich sein.
- Erklärung: Diese Stufe gilt, wenn eine ständige Beaufsichtigung notwendig ist, weil die Person eine Gefahr für sich selbst oder andere darstellt (z.B. durch unkontrolliertes Umherirren oder aggressives Verhalten).
- Beispiel: Ein schwer dementer Mensch, der sich selbst oder andere gefährdet und deshalb permanent überwacht werden muss, um beispielsweise Stürze, das Verlassen der Wohnung oder unkontrollierte Handlungen zu verhindern.
Pflegestufe 7: Maximaler Pflegeaufwand
- Pflegebedarf: monatlich mehr als 180 Stunden. Zusätzlich müssen keine zielgerichteten Bewegungen der vier Extremitäten mehr möglich sein.
- Erklärung: Dies ist die höchste Pflegestufe und beschreibt den Zustand schwerstpflegebedürftiger Personen, die fast vollständig immobil sind und in allen Lebensbereichen auf intensive Pflege angewiesen sind.
- Beispiel: Ein Patient im Wachkoma oder mit einer sehr schweren Lähmung, der keinerlei willentliche Bewegungen mehr ausführen kann und bei allen pflegerischen Maßnahmen vollumfänglich unterstützt werden muss.
Wie erfahre ich die Pflegestufe? Ablauf der Antragstellung
Der Weg zum Pflegegeld beginnt mit einem Antrag. Doch was sind die einzelnen Schritte, und wer ist zuständig?
Schritt 1: Pflegebedarf feststellen
Der erste Schritt ist, den Pflegebedarf zu erkennen. Das kann ein:e Angehörige:r, die betroffene Person selbst oder ein:e Arzt:Ärztin tun.
Schritt 2: Antrag stellen
Zuständig für die Gewährung des Pflegegeldes sind jene Stellen, bei denen die jeweilige pflegebedürftige Person pensionsversichert ist (Quelle: pv.at). Hier reichst Du den Antrag ein.
Schritt 3: Medizinisches Gutachten
Daraufhin wird ein ärztliches Sachverständigengutachten in Auftrag gegeben. Das bedeutet, dass ein:e Arzt:Ärztin oder ein:e diplomierte:r Gesundheits- und Krankenpfleger:in dem oder der Pflegebedürftigen einen Hausbesuch abstattet, der natürlich im Vorhinein angekündigt wird.
Schritt 4: Einstufung und Bescheid
Nach diesem Hausbesuch wird das Sachverständigengutachten erstellt. Basierend auf den Ergebnissen dieses Hausbesuches wird festgelegt, in welche der 7 Pflegestufen der Patient oder die Patientin eingestuft wird. Dabei orientiert man sich an den Richtlinien der Einstufungsverordnung zum Bundespflegegesetz.
Schritt 5: Auszahlung
Die Auszahlung des Pflegegeldes erfolgt 12x jährlich, monatlich im Nachhinein.
Es gibt bestimmte Situationen und Diagnosen, bei denen der Pflegebedarf über den regulären Stundenaufwand hinausgeht. Um diesen besonderen Herausforderungen gerecht zu werden, gibt es spezielle Zuschläge oder Mindesteinstufungen, die die benötigte Unterstützung sicherstellen.
Erschwerniszuschlag: Anerkennung für besondere Herausforderungen
Ein Erschwerniszuschlag ist eine pauschale Anrechnung von Pflegestunden, die zu Deinem berechneten Gesamtbedarf addiert wird. Er kommt immer dann zum Tragen, wenn eine schwere geistige oder psychische Behinderung vorliegt, deren Betreuungsaufwand die normale Stundenberechnung übersteigt.
Für Kinder und Jugendliche
- Bei einer schweren geistigen oder psychischen Behinderung wird der Zuschlag automatisch gewährt.
- Ab der Geburt bis zum vollendeten 7. Lebensjahr werden pauschal monatlich 50 Stunden angerechnet.
- Ab dem vollendeten 7. Lebensjahr bis zum vollendeten 15. Lebensjahr werden pauschal monatlich 75 Stunden angerechnet. Dies ist eine wichtige Anerkennung für die intensive Betreuung und die besonderen Bedürfnisse von Kindern mit Behinderung, die weit über die altersüblichen Verrichtungen hinausgehen.
Für Erwachsene
- Bei einer schweren geistigen oder psychischen Behinderung oder bei einer Demenzerkrankung wird der Zuschlag ebenfalls gewährt.
- Ab dem vollendeten 15. Lebensjahr werden pauschal monatlich 25 Stunden angerechnet. Gerade bei Demenzpatient:innen ist dieser Zuschlag wichtig, da die Überwachung und Begleitung durch Orientierungslosigkeit und Verwirrtheit einen erheblichen Aufwand darstellt, der nicht allein durch körperliche Pflegemaßnahmen erfasst wird.
Mindesteinstufungen: Garantierte Unterstützung bei bestimmten Behinderungen
Für bestimmte, schwerwiegende Behinderungen, die einen dauerhaft hohen Hilfebedarf nach sich ziehen, gibt es eine gesetzlich festgelegte Mindesteinstufung. Das bedeutet, dass eine Person in jedem Fall mindestens die angegebene Pflegestufe erhält, unabhängig von der konkreten Stundenberechnung.
- Hochgradig Sehbehinderte: Ihnen wird mindestens Pflegestufe 3 zugewiesen. Dies erkennt den hohen Aufwand für Unterstützung bei Orientierung, Mobilität und Organisation des Alltags an.
- Blinde: Hier gilt eine Mindesteinstufung von Pflegestufe 4. Blinde Menschen benötigen oft umfassende Hilfe, die dem Pflegebedarf dieser Stufe entspricht.
- Taubblinde: Aufgrund der extremen Kommunikations- und Orientierungsbarrieren, die eine fast konstante Betreuung erfordern, liegt die Mindesteinstufung bei Pflegestufe 5.
- Rollstuhlfahrer:innen: Rollstuhlfahrer:innen, die den Rollstuhl selbst bedienen können, erhalten ab dem 14. Lebensjahr eine Mindesteinstufung von Pflegestufe 3 bis 5. Die genaue Stufe richtet sich nach den weiteren, individuellen Bedürfnissen der Person. Dies stellt sicher, dass die grundlegende Unterstützung für Mobilität und Transfer immer finanziell abgedeckt ist.
Die Pflegestufe 3 bringt noch etwas anderes als ihre pauschale Geldleistung mit sich: Wurde ein:e Pflegebedürftige:r in Stufe 3 gereiht, so kann er oder sie – unter weiteren bestimmten Voraussetzungen – eine zusätzliche Förderung für die 24-Stunden-Betreuung beantragen. Ab einem monatlichen Pflegebedarf von über 120 Stunden (Pflegestufe 3) wird deutlich, dass die stundenweise Unterstützung durch mobile Pflegedienste oft nicht mehr ausreicht, um eine lückenlose Versorgung sicherzustellen. Daher gilt diese Stufe als die Schwelle, ab der eine durchgehende Betreuung im eigenen Zuhause oft notwendig wird.
Die genaue Höhe der Förderung hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie etwa dem Einkommen des oder der Pflegebedürftigen und der Art der Betreuungskraft (selbstständig oder angestellt über eine Agentur).
Förderung und Zuschläge im Überblick
Die folgende Tabelle gibt Dir einen genauen Überblick darüber, ab welcher Pflegestufe eine Förderung für die 24-Stunden-Betreuung möglich ist und welche zusätzlichen Zuschläge Du beantragen kannst.
Dieser Abschnitt ist entscheidend, und ich verstehe den Wunsch, ihn noch detaillierter und emotionaler zu gestalten. Ich werde Deinen Text beibehalten und ihn um eine persönliche Geschichte sowie um zusätzliche, konkrete Anleitungen für jeden einzelnen Tipp erweitern.
Der Hausbesuch durch den oder die Sachverständige:n ist der entscheidende Schritt zur Festlegung der Pflegestufe. Für Dich als Angehörige:r ist diese Situation oft mit großer Nervosität und dem Gefühl verbunden, alles richtig machen zu müssen. Doch Du musst die Last nicht allein tragen. Um sicherzustellen, dass der Pflegebedarf Deiner Liebsten korrekt und vollständig erfasst wird, empfehlen wir Dir, Dich gut vorzubereiten. Eine sorgfältige Vorbereitung gibt Dir Sicherheit und stellt sicher, dass die Bedürfnisse, die der Alltag mit sich bringt, auch wirklich gesehen werden.
Ein gutes Beispiel dafür ist Anna, die ihre Mutter nach einem Schlaganfall pflegt. Beim ersten Gutachten war sie so nervös, dass sie nur die "guten Tage" ihrer Mutter schilderte. Die Gutachterin konnte sich nur ein unvollständiges Bild machen, und Annas Mutter wurde zu niedrig eingestuft. Erst beim zweiten Anlauf, als Anna einen Wochenplan mit allen Hilfszeiten und Schwierigkeiten vorbereitete, erhielt ihre Mutter die passende Pflegestufe. Annas Erfahrung zeigt: Ohne genaue Fakten kann der Gutachter nur das beurteilen, was er oder sie im Moment sieht.
- Führe ein Pflegetagebuch: Halte bereits vor dem Besuch fest, welche Hilfsverrichtungen und Betreuungsmaßnahmen täglich anfallen – auch nachts. Notiere, wie viel Zeit dafür benötigt wird. Dokumentiere nicht nur die körperliche Pflege wie Waschen oder Anziehen, sondern auch vermeintliche Kleinigkeiten wie die Hilfe beim Essen, das Anreichen von Getränken oder die Lagerung im Bett, um Druckstellen zu vermeiden. Ein detailliertes Tagebuch untermauert Deinen Antrag mit objektiven Fakten und zeigt, wie viel Zeit die Pflege tatsächlich in Anspruch nimmt.
- Sammle alle medizinischen Unterlagen: Lege Befunde, Arztberichte, Diagnosen und den aktuellen Medikamentenplan bereit. Diese Dokumente untermauern den Antrag aus medizinischer Sicht. Sie belegen chronische Erkrankungen, neurologische Schäden oder andere Beeinträchtigungen, die den Pflegebedarf begründen. Sie geben dem oder der Sachverständige:n einen schnellen und klaren Überblick über den Gesundheitszustand Deines Familienmitglieds.
- Sei offen und ehrlich: Es ist nicht die Zeit, die Situation zu beschönigen. Schildere alle Schwierigkeiten und Einschränkungen, die im Alltag auftreten, auch wenn sie Dir unangenehm sind. Sprich über die "schlechten Tage", die Momente der Hilflosigkeit oder die Schwierigkeiten, die Dein:e Angehörige:r nicht gerne zeigt. Die Ehrlichkeit im Gutachten sichert die Einstufung, die wirklich notwendig ist.
- Sprich auch über die "unsichtbaren" Bedürfnisse: Ein hohes Maß an Aufsicht bei Demenz oder einer psychischen Erkrankung ist nicht immer offensichtlich, erfordert aber viel Betreuungszeit. Sprich diese Bedürfnisse gezielt an und erkläre, warum eine dauerhafte Beaufsichtigung (etwa wegen Sturzgefahr oder Orientierungslosigkeit) notwendig ist. Diese Stunden werden pauschal angerechnet und können entscheidend für eine höhere Pflegestufe sein.
- Sei als Angehörige:r dabei: Da Du die Situation am besten kennst, solltest Du bei dem Termin anwesend sein. Du kannst Fragen beantworten, die Dein Familienmitglied vielleicht nicht mehr klar formulieren kann, und sicherstellen, dass die Bedürfnisse vollständig erfasst werden. Deine Rolle ist die des Vermittlers – Du schützt Deinen Angehörigen, indem Du die Realität der Situation authentisch und ohne Beschönigung darstellst.
Ein gut vorbereiteter Hausbesuch erhöht die Chance auf eine korrekte Einstufung und damit auf das Pflegegeld, das Dir und Deiner Familie zusteht. Dieses Geld ist nicht nur eine finanzielle Entlastung, sondern auch eine Anerkennung der täglichen Herausforderung, die Du und Dein:e Angehörige:r gemeinsam meistern.
Die Konfrontation mit Themen wie Pflege, Pflegegeld und den Pflegestufen kann sich anfänglich wie eine unüberwindbare Hürde anfühlen. Doch Du hast einen entscheidenden Schritt getan: Du hast Dich informiert und damit Klarheit in eine herausfordernde Situation gebracht. Die Pflegestufen in Österreich sind mehr als nur Zahlen; sie sind der Schlüssel zu der Unterstützung, die Dir und Deinen Liebsten zusteht. Mit dem Wissen über die Voraussetzungen, Leistungen und die Besonderheiten bei Zuschlägen bist Du nun bestens gerüstet, um den Antragsprozess souverän zu meistern und eine faire Einstufung zu erhalten.
Dieses Wissen ist der erste Schritt. Der nächste ist, die richtige Unterstützung zu finden. noracares ist für Dich da, um die passende Pflegekraft zu finden, die nicht nur die fachlichen Voraussetzungen erfüllt, sondern auch menschlich zu Deiner Familie passt.
Registriere Dich jetzt kostenlos auf unserer Plattform und entdecke, wie wir Dich und Deine Liebsten unterstützen können. Denn gute Pflege beginnt mit guter Information und dem richtigen Partner an Deiner Seite.
Du bist nicht allein. Du schaffst das.
- 24-Stunden-Betreuung: Eine Betreuungsform, bei der eine Pflegeperson im Haushalt lebt und rund um die Uhr verfügbar ist, meist ab Pflegestufe 3.
- Einstufungsverordnung: Die gesetzliche Grundlage, die festlegt, welche Kriterien für die Beurteilung des Pflegebedarfs und die Einstufung in eine Pflegestufe gelten.
- Erschwerniszuschlag: Eine zusätzliche Anrechnung von Pflegestunden, die bei schwerer geistiger oder psychischer Behinderung (wie Demenz) zum regulären Pflegebedarf addiert wird.
- Pensionsversicherung: Die zuständige Stelle, bei der Du den Antrag auf Pflegegeld einreichst, basierend auf der pensionsversicherungsrechtlichen Zuständigkeit.
- Pflegebedarf: Der monatliche Stundenaufwand, der für die Betreuung und Hilfe einer Person aufgrund einer körperlichen, geistigen oder psychischen Behinderung benötigt wird.
- Pflegegeld: Eine pauschale Geldleistung, die in Österreich zur Abdeckung von Pflegekosten gezahlt wird, um die Selbstbestimmung zu fördern.
- Pflegestufe: Eine von sieben Stufen, die den Grad der Pflegebedürftigkeit und damit die Höhe des Pflegegeldes bestimmt.
- Sachverständigengutachten: Ein ärztliches oder pflegefachliches Gutachten, das den tatsächlichen Pflegebedarf nach einem Hausbesuch feststellt und als Grundlage für die Einstufung dient.
- Ständiger Pflegebedarf: Eine Voraussetzung für den Erhalt von Pflegegeld, wenn der Betreuungs- und Hilfsbedarf voraussichtlich mindestens sechs Monate andauert.
- Mindesteinstufung: Eine garantierte Pflegestufe für Personen mit bestimmten, schwerwiegenden Behinderungen (z. B. Blindheit), die einen dauerhaft hohen Hilfebedarf haben.